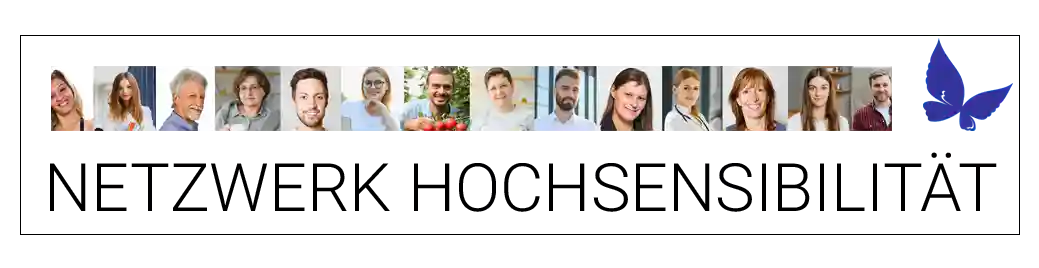Grübeln: Was wirklich hinter dem Gedankenkarussell steckt

(Von Jessica Ascher) Viele meiner Klienten sagen: „Ich weiß, dass mir das Grübeln nicht guttut – aber ich kann einfach nicht aufhören.“

Und das kenne ich nur allzu gut auch von mir selbst, denn:
Grübeln ist keine Kopfsache, sondern eine Schutzstrategie
Kennst du das? Du liegst abends im Bett, willst eigentlich schlafen und während dein Körper immer ruhiger wird, wird dein Kopf dafür immer lauter. Ein Gedanke jagt den nächsten:
- „Was hab ich heute alles nicht geschafft?“
- „Was steht Morgen an?“
- „Wie hat er das vorher wohl gemeint?“
- „Ist bei ihm nun der Eindruck entstanden, dass ich labil bin?“
- „Ah ich muss unbedingt noch bei der Autowerkstatt anrufen!“
Dein Kopf ist voll, Gedanken kreisen endlos und obwohl du alles fünfmal durchdacht hast, fühlt sich nichts wirklich klar an?
Dein Nervensystem sucht Sicherheit
Dein Gehirn denkt:
„Wenn ich nur lange genug nachdenke, finde ich die perfekte Lösung – und dann bin ich endlich beruhigt.“
Wir denken, um Kontrolle zu spüren. Um vorbereitet zu sein. Um nicht überrascht oder verletzt zu werden. Und doch merken wir: Je mehr wir denken, desto unklarer fühlen wir uns.
Das Paradoxe – Gedanken lösen keine Unsicherheit – sie verlängern sie oft.
Es ist ein Mechanismus, der sich selbst verstärkt:
- Bekanntheit fühlt sich sicher an. Grübeln ist vertraut, also greift dein System lieber darauf zurück, auch wenn es belastet, denn so sind wir doch auf alle Eventualitäten vorbereitet, oder?
- Kurzfristige Entlastung. Im Moment des Nachdenkens scheint das Problem kontrollierbarer – wir kommen „der perfekten Lösung“ ein klein wenig näher – auch wenn die Erleichterung nie lange anhält, geschweige denn zur Gänze erreicht wird.
- Gefühle vermeiden. Grübeln hält dich im Kopf, fern von unangenehmen Gefühlen wie Angst, Trauer oder Wut.
Das Paradoxe ist dabei:
Je mehr wir nachdenken, desto unsicherer fühlen wir uns.
Das Karussell verstärkt genau das, wovor wir uns schützen wollten. Und deshalb rutschen wir trotz besseren Wissens immer wieder hinein. Für eine kurzfristige Befriedigung – auch wenn es langfristig belastet.
Warum sind Hochsensible vom Grübeln oft betroffen?
Hochsensible Menschen (HSP) neigen besonders zum Gedankenkarussell, weil ihr Nervensystem Informationen intensiver aufnimmt und gründlicher verarbeitet. Wo andere eine Situation oberflächlich abhaken, nehmen HSPs jedes Detail, jede Nuance und jede mögliche Konsequenz wahr – und ihr Gehirn sucht unermüdlich nach Mustern und Erklärungen.
Hinzu kommt häufig eine ausgeprägte Empathie:
Hochsensible spüren Stimmungen und unausgesprochene Signale stark, was schnell zu Selbstzweifeln und Verantwortungsgefühlen führt.
Dadurch werden Gedanken nicht einfach abgeschlossen, sondern immer wieder von neuen Perspektiven „angefüttert“.
Die tiefe Reflexionsfähigkeit, die eigentlich eine Stärke ist, verwandelt sich so leicht in endloses Grübeln, denn:
Ein Gedanke hört selten nach einer Schleife auf, sondern zieht einige weitere Runden nach sich.
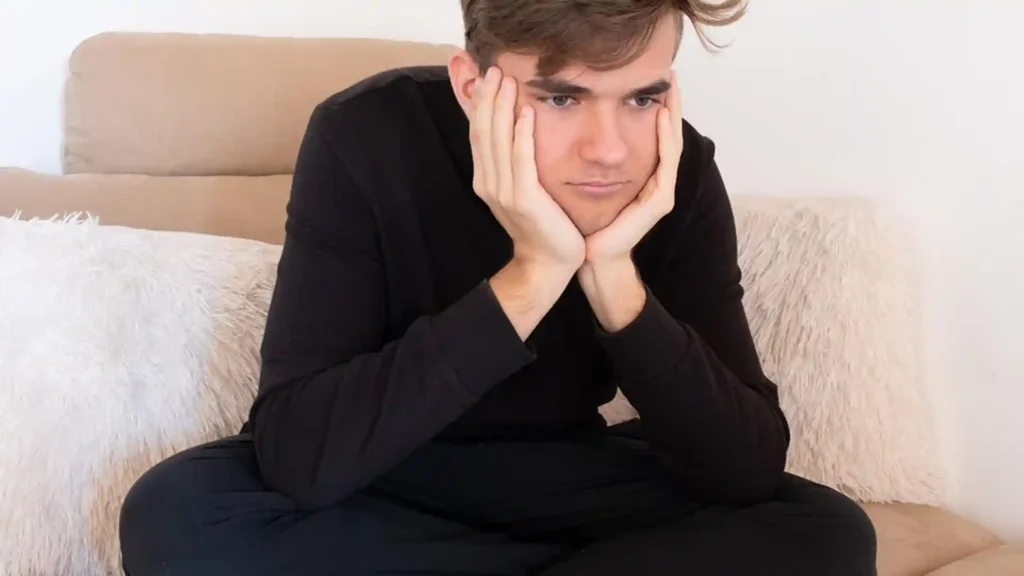
Versteckte „Krankheitsgewinne“ bzw. Funktion des Grübelns
Ein wichtiger Aspekt, den viele übersehen: Grübeln erfüllt unbewusste Bedürfnisse.
- Vermeidung: Solange ich denke, muss ich nicht entscheiden.
- Kontrollillusion: Ich habe das Gefühl, vorbereitet zu sein.
- Schutz vor Gefühlen: Denken verhindert, dass ich Schmerz oder Ohnmacht spüre.
- Selbstwert: Grübeln bestätigt mir, dass ich gründlich und verantwortungsvoll bin.
Wer diese versteckten Gewinne erkennt, kann neue, gesündere Wege finden, um Sicherheit, Schutz oder Selbstwert zu erleben. Der eigentliche Gamechanger:
Gedanken nicht stoppen – sondern nicht festhalten.
Viele Menschen versuchen, das Gedankenkarussell anzuhalten, indem sie die störenden Gedanken wegdrücken oder mit positiven Gedanken überschreiben. Doch genau das verstärkt oft den inneren Druck.
Der entscheidende Unterschied liegt darin, Gedanken auftauchen zu lassen, ohne sie festzuhalten. Ein Gedanke darf da sein. Aber du musst ihm nicht folgen. So entsteht innerer Raum, in dem dein Kopf von allein ruhiger werden kann. Denn:
- Gedanken sind wie Züge – du musst nicht in jeden einsteigen.
- Loslassen ist keine Technik, sondern eine Entscheidung: nicht alles kontrollieren zu müssen.
4 Tipps gegen übermäßiges Grübeln
Das ist leicht gesagt, ich weiß. Deshalb hier ein paar nicht ganz so offensichtliche Werkzeuge und Strategien zum Ausstieg aus dem Gedankenkarussell, die ich in Coachings und Seminaren gerne weitergebe:
1. Körperanker statt Kopfkino:
Unser Nervensystem ist schneller als jeder Gedanke. Lege die Hand auf Herz oder Bauch, atme bewusst aus und sage dir:
„Ich bin sicher – hier und jetzt.“
Jede Form von Körperstimulation, sei es Ausschütteln, Abklopfen, Akupressur Matte, Kneipen, Barfuß laufen, zwei Minuten Tanzen: Oft braucht es nicht mehr, um das Karussell zu verlangsamen.
2. Zeitliche Begrenzung – das Grübel-Tagebuch:
Aus dem Kopf, aufs Papier. Plane dir 10 Minuten Grübelzeit am Tag ein. Schreibe alles ungefiltert auf. Manche mögen das als Morgenseiten, andere Zwischendrin je nach Bedarf, oder abends um gedankenfrei(er) einschlafen zu können. Danach klappe das Heft zu.
So signalisierst du deinem System:
„Es gibt Raum für Gedanken – aber nicht 24/7.“
3. Gefühle zulassen statt sie wegdenken:
Hinter vielen Schleifen steckt ein ungefühltes Gefühl: Angst, Trauer, Wut. Wenn du statt weiterzudenken für 2 Minuten ins Spüren gehst (z. B. Hand aufs Herz und nur fühlen, ohne Worte). Lass es zu, auch wenn der erste Impuls Ablenken oder Unterdrücken ist.
Dann löst sich das Bedürfnis nach Dauerschleifen oft auf.
Weil wir wieder bei uns ankommen, im Hier und Jetzt, im Körper wo wir das Leben spüren können.
4. Fragen statt Antworten suchen:
Grübeln sucht nach der perfekten Antwort. Befreiender ist, offene Fragen zu stellen:
„Was wäre das kleinste mögliche nächste Schrittchen?“
So verlässt du den Druck der „EINEN richtigen Lösung“. Und Common: wir leben alle dieses Leben zum ersten Mal, ich sage das als große Perfektionistin: Perfektion gibt es nicht, verabschiede dich davon! Probier’s aus! Es könnte ja gut werden 😊

Fazit: Grübeln und Gedankenkarussell
Gedankenkarussell stoppen heißt nicht, nicht mehr zu denken.
- So wird aus dem Gedankenkarussell kein Feind mehr – sondern ein Hinweis: „Schau hin, was du gerade wirklich brauchst.“
- Das Gedankenkarussell will dich nicht quälen – es will dich schützen.
- Doch Sicherheit entsteht nicht durch endloses Denken, sondern durch Vertrauen, Fühlen und Loslassen im Hier und Jetzt.
Ich wünsche dir viele kleine gedankenfreie Momente, in denen du spürst: „Ich bin sicher – auch ohne alles bis ins Letzte durchzudenken.“ 🧡
Alles Liebe, deine Jessy
Jessica Ascher, Mentaltrainerin für Hochsensibilität & Stressmanagement, Netzwerkmitglied für 72766 Reutlingen (D), www.jessicaascher.com
Bücher für hochsensible Menschen
Häufig gestellte Fragen zu Grübeln (FAQ)
Weil dein Nervensystem in dem Moment nach innerer Sicherheit sucht. Das Grübeln ist ein unbewusster Versuch, Kontrolle über Unsicherheit zu bekommen. Je mehr du denkst, desto mehr verlierst du dich im Kopf und entfernst dich von deinem Körpergefühl. So entsteht ein Kreislauf, der das Einschlafen erschwert.
Hochsensible verarbeiten Reize sehr tief und speichern viele Eindrücke emotional. Sie reflektieren intensiv und stellen sich oft selbst infrage. Das führt dazu, dass sie besonders anfällig für Grübelschleifen sind, vor allem wenn sie in Stress geraten oder sich überfordert fühlen.
Grübeln ist meist ein Schutzmechanismus, der unangenehme Gefühle überdeckt. Es geht selten um Lösungen, sondern darum, innerlich beschäftigt zu bleiben, um nicht fühlen zu müssen. Oft stehen dahinter unbewusste Themen wie Selbstwert, Kontrolle oder alte Verletzungen.
Indem du beginnst, die Gedanken einfach wahrzunehmen, ohne sie festzuhalten. Statt weiterzudenken, spüre in deinen Körper, bewege dich, atme bewusst oder lenke dich sanft zurück in den Moment. Auch das Aufschreiben kann helfen, um Abstand zu gewinnen.
Hilfreich sind kurze Achtsamkeitsübungen, Atempausen, bewusste Körperbewegung, Barfußgehen, Journaling oder eine sogenannte Grübel-Zeit am Tag. Entscheidend ist, regelmäßig aus dem Kopf in den Körper zu kommen und die eigenen Grenzen rechtzeitig zu spüren.